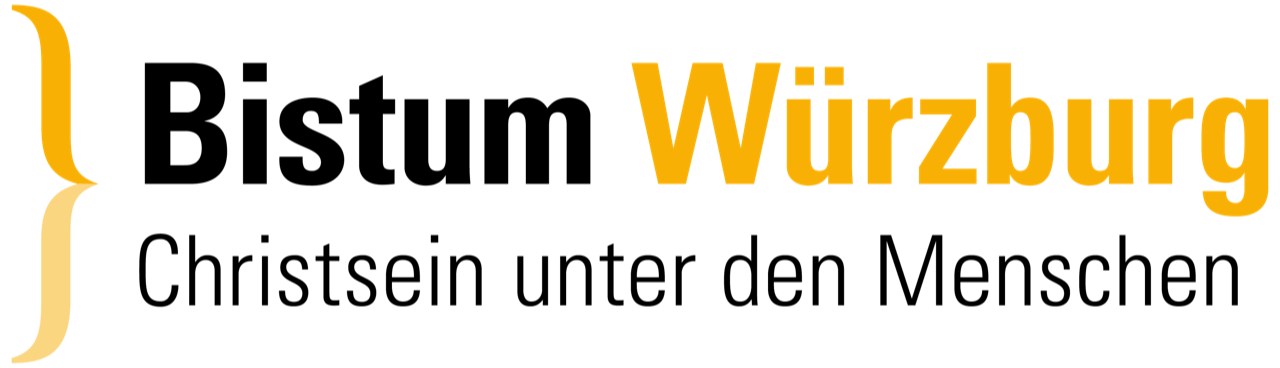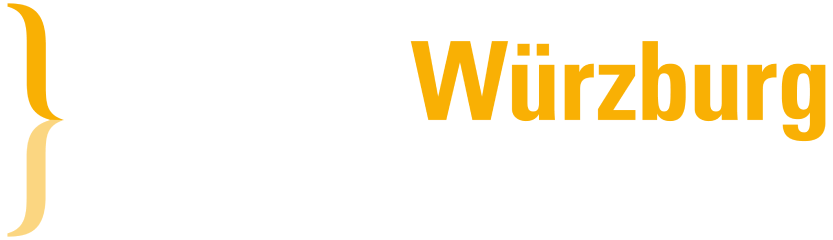Zur Zeit seiner Gründung lag Mariabuchen an einem Waldweg, der Teil der kürzesten Wegverbindung zwischen Lohr und Karlstadt war. Der Weg führte von Lohr über die Mainfähre nach Sendelbach und von hier über den bewaldeten Buchenberg in das nach der Gemeinde Hausen benannte „Häuser Tal", das heute Buchental genannt wird. Von hier führte der Weg zum Weiler Erlenbach, über Wiesenfeld und Karlburg oder Rohrbach und Mühlbach nach Karlstadt.
Wiesen und Wälder wurden in früheren Jahrhunderten als Viehweiden genutzt. Einem Viehhirten, der seine Herde durch das Buchental trieb, verdankt Mariabuchen der Legende nach seine Entstehung. Etwas abseits des Weges von Lohr nach Karlstadt soll der fromme Schäfer einen Platz gefunden haben, der es ihm besonders angetan hatte: Er schnitzte ein Bildnis der schmerzhaften Muttergottes mit dem toten Heiland auf dem Schoß und stellte es in die Asthöhle einer alten Buche. Das kleine Waldheiligtum sprach sich herum, und alsbald wandten sich viele Menschen hilfesuchend an die Muttergottes in der Buche.
Mit der Zeit wuchs das Marienbild ein und geriet in Vergessenheit. Allerdings – so sagt man – konnten Ungläubige die Buche mit dem verborgenen Bildnis darin nicht passieren und wurden von einer unsichtbaren Kraft zurückgehalten. Eines Tages kam wieder ein Ungläubiger des Weges. Als er nicht weitergehen konnte, zog er zornig sein Schwert und stach in den alten Baum. Da hörte er eine klagende Stimme dreimal „Oh Weh" rufen. Der Ungläubige zog sein Schwert zurück und sah, dass es an der Spitze blutig war. Erschrocken sei er wie gebannt stehen geblieben und vermochte nicht weiterzugehen. Erst hinzugekommene Christen ihn aus seiner Starre befreien. Auf den Bericht des Mannes hin habe man die Buche gefällt und darin das Gnadenbild gefunden – mit einem blutigen Stich am Rücken. Der Ungläubige sei später Christ geworden und habe sich fortan in der Nähe von Mariabuchen aufgehalten.
Valentin Leucht, von dem die älteste schriftliche Überlieferung dieser Legende stammt (1591), spricht in seinem Bericht von einem Juden, der aus Zorn sein Messer in den Baum stach. Die Legende des „Judenfrevels" ist nach Ansicht von Wolfgang Brückner / Wolfgang Schneider „im gegenreformatorischen Kontext ihrer Erstveröffentlichung zu sehen: „Leucht ging es vor allem darum, den Kult um Marienbilder gegen Angriffe von protestantischer Seite zu verteidigen und die Echtheit ihrer Wunderzeichen zu beweisen." Im 20. Jahrhundert wurde die antijüdische Sage zu vollem Recht kritisiert, weshalb man 1970 alle diesbezüglichen Darstellungen aus der Kirche entfernte.
Über das tatsächliche Ursprungsjahr von Mariabuchen herrscht Uneinigkeit. Die Jahreszahl 1395, die lange als Geburtsstunde des Wallfahrtsortes galt, hat sich als Rückrechnung entpuppt: So heißt es in den „Miracula" von Valentin Leucht aus dem Jahr 1595, dass das Marienbildnis vor „zweyhundert Jahren" aufgefunden wurde, also 1395. Einen weiteren Hinweis gibt eine Inschrift auf der Sockelmauer an der Kirchenwand: 1406 I.S.M. (1406 Inventio Sanctae Mariae / Auffindung der heiligen Maria) heißt es da, was auf den vermutlich historischen Kern der Mariabuchener Gründungslegende anspielt.
Historisch fassbar wird die erste Kapelle erst durch einen Ablassbrief von 1434, in dem der erste Kapellenbau in der „Buchen" erwähnt wird. Die Betreuung der Wallfahrt oblag den Benediktinern von Neustadt am Main, zu deren Gebiet die Kapelle gehörte. In den Jahren 1613 bis 1617 ließ Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn die alte Buchenkapelle renovieren und um einen neuen Chor erweitern. In der Barockzeit erblühte die Wallfahrt in voller Pracht: Fürstbischof Johannes Gottfried von Guttenberg ließ die Kirche 1692 abreißen und vom Steinfelder Baumeister Christoph Nemlich neu erbauen. Es entstand ein schlichter Saalbau mit eingezogenem polygonalen Chor und Turm an der Nordseite. Die Weihe vollzog Weihbischof Stephan Weinberger am 29. Mai 1701. Für die Wallfahrtsseelsorge wurde in Steinfeld, wozu Mariabuchen bis heute gehört, eine Kaplansstelle eingerichtet.